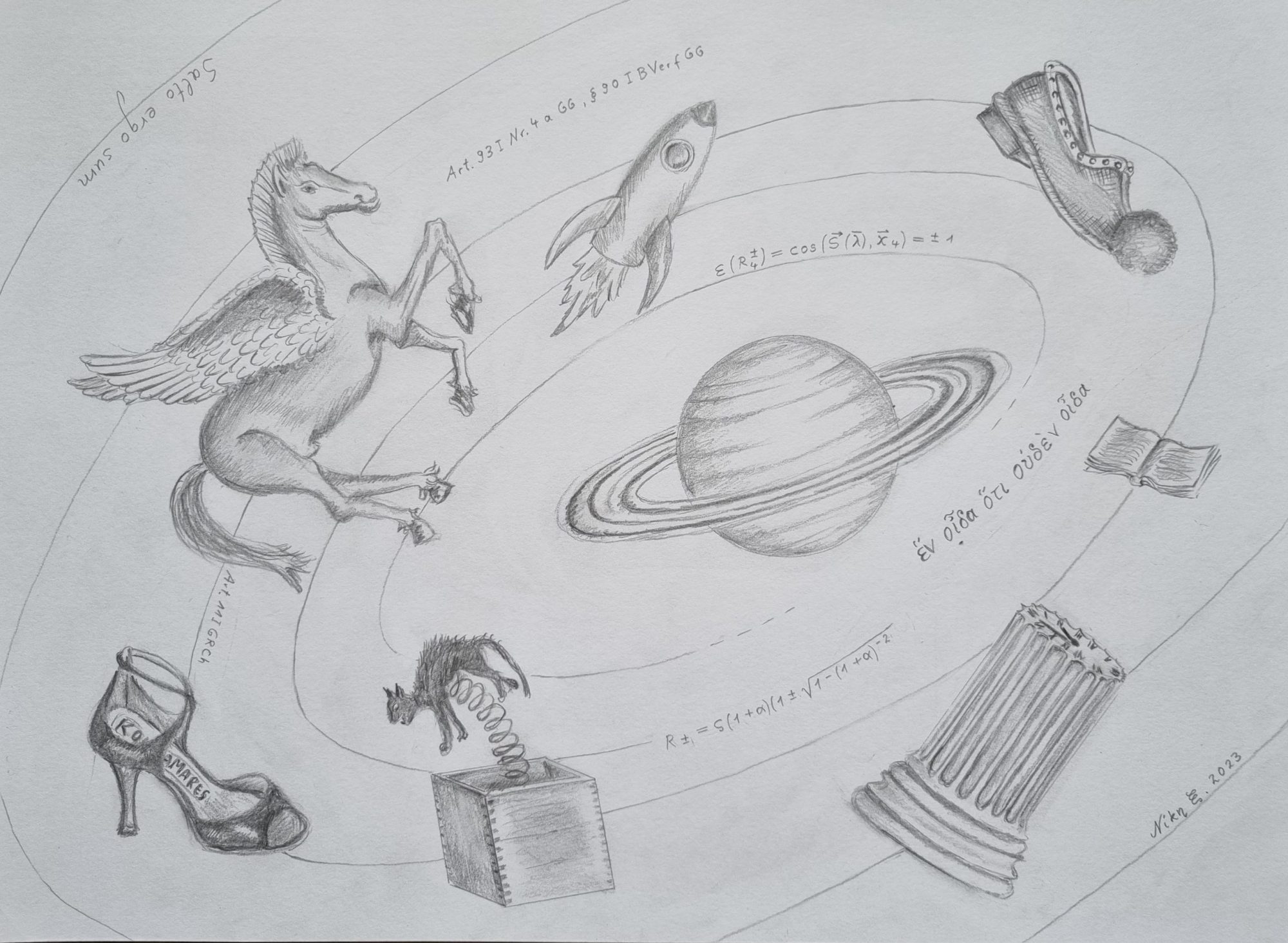Rund um die Weihnachtszeit bis hin zum Jahreswechsel klagen besonders viele Menschen über Einsamkeit. In dieser Zeit fühlen sich vor allem solche, die alleine leben, ledig, getrennt, geschieden oder verwitwet sind, stark isoliert. Aber Einsamkeit hängt nicht bzw. kaum von der Wohnsitation oder vom Beziehungsstatus ab, sondern ist vielmehr ein rein innerer Gemütszustand, ein Gefühl. Denn das Paradoxon ist, nicht nur Alleinstehende fühlen sich einsam. Selbst solide eingebettet in Partnerschaft, Familie und sozialen Beziehungen können sich Menschen einsam und isoliert fühlen. Nicht selten ist sogar gerade das intensive Um-sich-Scharen sozialer Kontakte ein Indiz für innere Leere, ein fragiles Ego sowie empfundene Einsamkeit, welches durch das Menschensammeln kompensiert werden soll. Meist erfolglos, denn die Einsamkeit wird damit nicht an den Wurzeln gepackt.
Zwar spiegelt sich diese Notlage der Betroffenen an Weihnachten bzw. im Monat Dezember, anders als oft angenommen, nicht in den Suizidraten des Statistischen Bundesamtes wider, aber dennoch hat Einsamkeit zweifelsohne pathologischen Charakter und verdient gerade in dieser Zeit besondere Aufmerksamkeit.
Um das Problem zu verstehen, ist es wichtig, sich mit den Ursachen zu befassen:
Seit Kindesalter wird uns beigebracht, dass Alleinsein ein schlechter Zustand sei, vor dem man sich dringend hüten sollte. Diese Erziehung führt unweigerlich zur Fehlinterpretation dieses Zustandes, sodass sich Denkmuster etablieren wie „Alleinsein ist schlecht.“, „Alleinsein macht krank.“ Oder „Nur wer Menschen um sich hat, ist glücklich.“ Der Mensch ist zwar bekanntlich ein soziales Wesen und in der Gruppe sind viele alltägliche Herausforderungen leichter zu erledigen, aber er strebt gleichzeitig auch nach Freiheit – und Panik hält ihn bekanntlich davon, sich frei zu entfalten.
Wer sich ständig mit dem Alleinsein oder besser dem Vermeiden von Alleinsein befasst, ist innerlich wie getrieben und verliert den Kontakt zu sich selbst. Für die Betreiber von Straßen-Cafés ist das eine prima Sache. Besonders solche in südlicheren Gefilden wie etwa in Griechenland sind voll von Leuten, die ihre eigenen Gefühle und Gedanken mit sinnlosem, aber staatstragend anmutendem Geplapper übertönen und sich gegenseitig unausgesprochen bestätigen, besonders sozial zu sein. Aber mit einem gesunden Sozialverhalten hat das exzessive Kontaktheischen und pingponghafte Austauschen nicht viel zu tun. Spätestens wieder daheim eingetroffen, fühlen sich viele von ihnen wieder leer. Wer außerdem zu sozial ist und seine Orientierung ausschließlich in der Gesellschaft sucht, ist argumentum e contrario womöglich latent gegen sich selbst, was sicherlich nicht für eine mentale Gesundheit spricht.
Anderes Beispiel: Viele Menschen legen ein gutes Buch nach kurzer Zeit, manchmal schon nach 2-3 Seiten Lektüre, wieder weg, um mit dem Smartphone auf Facebook, Instagram, Tinder, WhatsApp und Co. zu checken, was Freunde und Bekannte gerade so treiben, mit ihnen in Kontakt zu treten und die nächste Verarbredung klarzumachen. Zu groß wird in ihnen die Sorge und damit der Druck, etwas zu verpassen oder den Anschluss zu verlieren. Dieses Verhalten kann man besonders gut am Strand, im Flugzeug oder im Bus beobachten. Wer nicht einmal willens oder in der Lage ist, sich eine halbe Stunde lang in einen Text zu vertiefen und diesen semantisch zu erfassen und diese Zeit lieber in oberflächliche soziale Bestätigung investiert, dessen mentale Balance ist mindestens in Schieflage, wenn nicht sogar komplett aus dem Fugen.
Neulich tauschte ich mich mit einem Bekannten aus, einem französischen Künstler. Er lobte überraschend meine Fähigkeit zum zeitweiligen Alleinsein. Schon lange pflege ich regelmäßige Rückzugsphasen, in denen ich bewusst nur für mich sein möchte und Gesellschaft vermeide. Früher, etwa während der Schulzeit, waren es meist nur einige Stunden oder ein halber Tag. Später als Erwachsene zog ich mich hin und wieder sogar für mehrere Wochen komplett allein zurück. Mit meinen ungestörten Routinen und in der Gesellschaft meiner eigenen Gedanken ging es mir gut in meinem „Exil“ und ich kehrte anschließend immer erfrischt zurück zu meinen Liebsten.
Bis zu diesem Austausch mit meinem Bekannten, war ich mir nicht sicher, ob mit mir etwas nicht stimmte, zumal die Gesellschaft ausnahmslos die Bedeutung von Zusammensein hochhält und das Alleinsein gleichzeitig verteufelt. Diesem Diktat kann man sich nur sehr schwer entziehen. Aber mittlerweile sehe ich das anders, entspannter, denn faktisch leide ich in diesen Phasen nicht. Was sich für mich gut anfühlt, ist für mich gut. Punkt.
„Um eine gute Beziehung zu anderen zu haben, sollte man sich eingestehen, dass man selbst der einzige wirkliche „Freund“ ist, mit dem man den Rest seiner Tage verbringen werde“, teilte mir mein Bekannter mit und berief sich dabei auf die Lehren des indischen Philosophen Jiddu Krishnamurti (*1895 – †1986), nach welchen die Einsamkeit für die Selbstfindung und -kultivierung nicht nur gut und sinnvoll, sondern unabdingbar ist. Krishnamurti ist in Philosophenkreisen alles andere als unbekannt, aber der breiten Masse der deutschen Gesellschaft ist er nicht unbedingt geläufig. In Schule und Universität habe ich diverse große Philosophen studiert, aber Krishnamurti bislang nicht. Möglicherweise liegt dies darin begründet, dass er jedwede Autorität ablehnte, die Gesellschaft als Ratgeber und Orientierung in Frage stellte, Konkurrenzdenken und sogar das Denken selbst kritisierte und die Menschen dazu ermutigte, wahrhaft unabhängig von anderen zu sein und sich selbst der beste Lehrer und Anführer zu sein. Gut vorstellbar, dass dies Machthabern in Politik und Wirtschaft aufstößt, wenn an altbewährten Dogmen (z.B. die Gesellschaft weiß immer, was für dich gut ist) gerüttelt wird. Eine Seele, in der Klarheit und Ordnung herrschen, ist schwer zu unterwerfen. Insofern ist es kaum verwunderlich, dass solche Philosophien nicht allzu hoch im Kurs steht.
Diesbezüglich spüre ich nach meinen ersten rudimentären Recherchen jedenfalls deutlich Nachholbedarf und habe zwei deutschsprachige Bücher zu Krishnamurtis Lehren gekauft. Das eine bietet einen ausführlichen Überblick über seine Theorien und das andere konzentriert auf das Thema Meditation.
Zwischenfazit: Möglicherweise löst die Furcht vor dem Alleinsein Einsamkeit überhaupt erst aus. Bewusstes zeitweiliges Alleinsein und effiziente Meditation könnten das Gegenmittel sein und die Einsamkeit heilen.