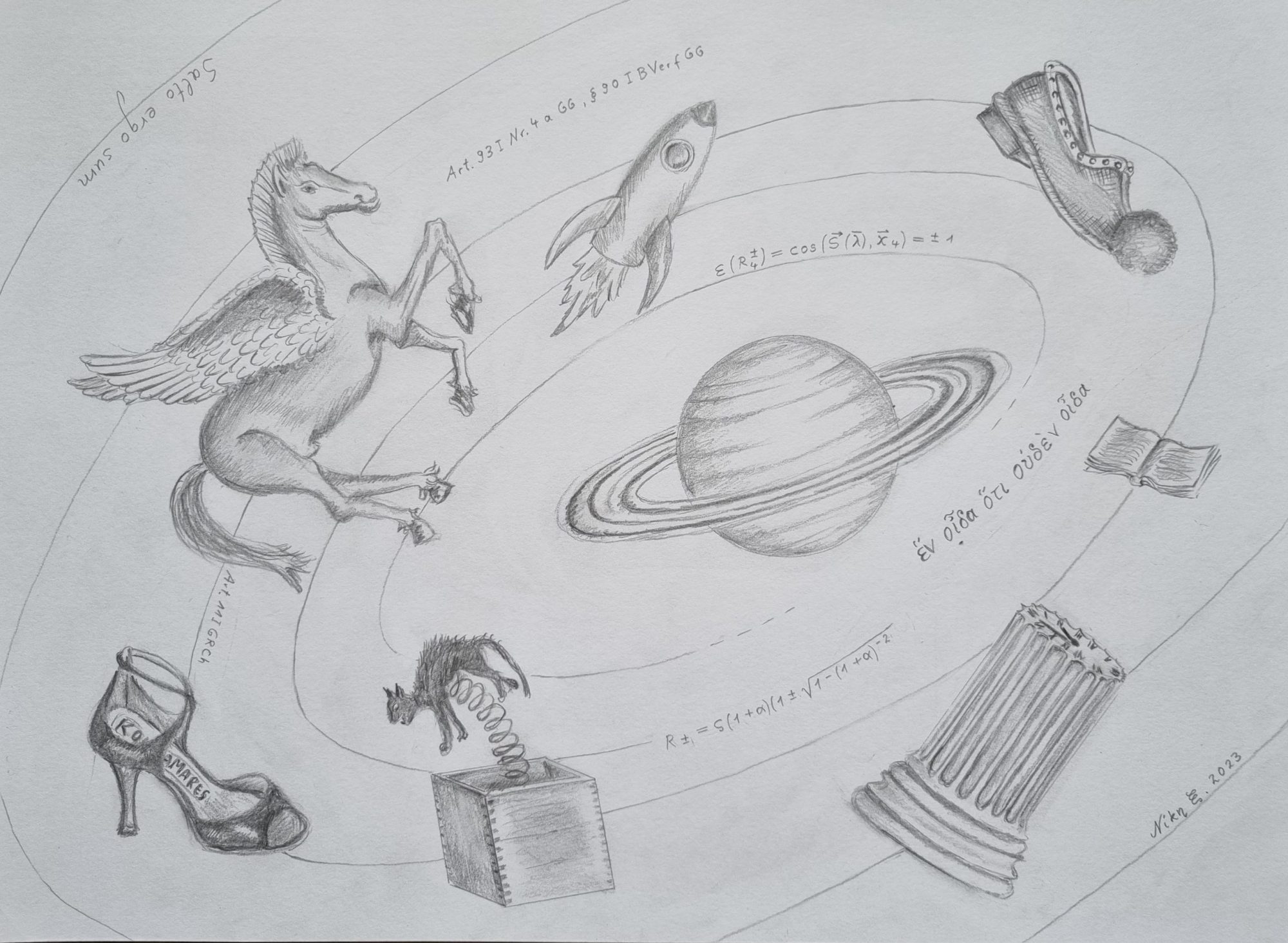Das schwere Zugunglück, das sich am 28.02.2023 in Griechenland zwischen Thessaloniki und Athen ereignete, traf die griechische Nation unvermittelt mitten ins Herz. Ein Güterzug kollidierte frontal mit einem Personenzug. Mindestens zweiundvierzig Menschen starben nach derzeitigem Kenntnisstand. Darunter viele Schüler und Studenten, die am Wochenende zuvor Karneval gefeiert hatten. Unter den rund 350 Fahrgästen, die sich im Personenzug befanden, werden gegenwärtig noch viele Menschen vermisst.
Ein Bahnmitarbeiter wurde bereits festgenommen. Dieser steht unter Verdacht, die Gleisen falsch gestellt zu haben. Das elektronische Fahrleitsystem soll schon länger nicht korrekt funktioniert haben, weswegen die Gleisen in dem betreffenden Streckenabschnitt offenbar von Hand gestellt wurden. Die griechische Regierung verspricht umfassende Aufklärung. Der amtierende Verkehrsminister ist bereits zurückgetreten.
Viele Griechen schreien derzeit nach Vergeltung. So wie viele Katastrophen, droht auch diese zum Medienevent zu mutieren. Jeder möchte seine Meinung wie einen „Hut in den Ring werfen“ und promotet diese geradezu zwanghaft, als kämpfe er höchstpersönlich an der vordersten Front des Unglücks für die Wahrheit und Gerechtigkeit.
Aber wieso ist das so? Warum sind die Menschen bei Katastrophen apokalyptischen Ausmaßes geradezu euphorisch?
Katastrophen haben Menschen schon immer angezogen. Deshalb sprechen Psychologen von der sog. „Katastrophenlust“. Die Kenntnisnahme und die gedankliche Auseinandersetzen mit einem Unglücksfall erzeugt im Menschen in erster Linie Angst. Gleichzeitig werden Glückshormone, sog. Endorphine, ausgeschüttet. Dies erscheint auf den ersten Blick paradox, ist jedoch evolutionspsychologisch betrachtet überlebenswichtig, um selbst in auswegslosen Situationen die Handlungsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Hinzu kommt der händeringende Wunsch nach Kontrolle einer außer Kontrolle geratenen Situation. Diese Gefühle entstehen unwillkürlich und dienen, vereinfacht dargestellt, dem eigenen Überleben. Weniger unwillkürlich ist indes der Umgang des Menschen mit seinen Gefühlen.
Durch die öffentliche Auseinandersetzung mit einem Unglücksfall entsteht ein gewisser sozialer Druck im Individuum. In der Konkurrenz- und Leistungsgesellschaft, die man insbesondere in hochentwickelten Zivilkulturen vorfindet, möchte niemand den Anschluss verlieren. Wer nicht zeitnah eine Meinung zu einem bestimmten Ereignis aus dem Ärmel schüttelt und Farbe bekennt, gilt schnell als uninformiert oder desinteressiert. Zu langes Nachdenken ist out. Daher fühlen sich viele Menschen gezwungen, zu einer schnellen Beurteilung zu gelangen, um sich erst gar nicht einem solchen Vorwurf auszusetzen.
Der Schuldige scheint beim vorliegenden Zugunglück für Viele schnell gefunden: der Staat ist schuld, der mit diesen oder jenen Maßnahmen, wie etwa der Privatisierung des Zugverkehrs, überhaupt den fatalen Weg bereitet hat, sodass das in einem wohlgemerkt moderenen technischen Zeitalter Unmögliche auf erschreckende Weise möglich wurde. Mit „dem Staat“ hält man sich bewusst wage. Hakt man in Dialogen nach, wer oder was konkret gemeint ist, ob etwa eine bestimmte Behörde, ein Amt, die gesamte Regierung, der Polizeiapparat oder das Parlament schuld ist, hält man sich mangels Kenntnis der Zusammenhänge oder mangels Mut, seine Überlegungen näher auszuführen, dann doch lieber bedeckt. Und wie genau „Schuld“ definiert wird und wer nach juristischen Maßstäben – ganz konkret – für die zahlreichen Toten und Verletzten verantwortlich ist, interessiert letztendlich fast schon nicht mehr. Durch das Bedürfnis nach Bestätigung konsumiert man im Nachfolgenden ohnehin meist nur noch die Informationen, die den eignenen Standpunkt stützen, welcher wiederum in den meisten Fällen jedoch nicht einmal aus einem eigenständig durchlaufenen und fundierten Meinungsbildungsprozess heraus geboren wurde, sondern oft nur unreflektiert nachgeplappert ist.
Es wird sich – überspitzt formuliert – munter im Rudel empört und gejammert. Während ein Teil der griechischen Öffentlichkeit durch den Unglücksfall tatsächlich emotional kompromittiert ist, schreien andere nur auf, um Teil eines besonderen größeren Ereignisses zu sein oder um das Unglück zugleich zur Kanalisation ihrer Unzufriedenheit zweckzuentfremden, welche ihren Ursprung meist gar nicht in dem Ereignis selbst hat, sondern aus anderen Ereignissen oder persönlichen Lebensumständen rührt. Das Ereignis wird somit zum reinen Aufhänger und zur Projektionsfläche für die eigenen Defizite und Frustration (z.B. durch Misserfolg im Beruf). Zwei Fliegen mit einer Klappe!
Wie viele von ihnen beißen keine 10 Minuten später, nachdem sie sich gekünstelt und lauthals empört haben, tiefenentspannt in die dampfende Tiropita und sind insgeheim froh darüber, dass weder sie selbst noch Nahestehende im Unglückszug saßen?
Wer tatsächlich innerlich erschüttert ist von den Meldungen und den Bildern des Zugunglücks, die um die Welt gehen, benötigt jedenfalls einige Zeit, um einen klaren Gedanken zu fassen und das Geschehene zu bewerten und anschließend zu betrauern.
Teilhabe mag ein verständiches und tief verankertes Bedürfnis des Menschen sein. Dies gilt gleichermaßen für erfreuliche Ereignisse wie z.B. der Fußball-WM wie auch für tragische Ereignisse wie z.B. die Covid19-Pandemie oder 9/11. Die Art der Berichterstattung ermutigt häufig zu dieser Art von Teilhabe, um sich auch künftig Auflagen oder Einschaltquoten zu sichern. Während seriöse Nachrichten-Dienste sachlich zu einem Ergebnis informieren und den Informationskonsumenten zu eigenen Recherchen und Überlegungen ermutigen, kauen andere Anbieter dem Adressaten neben der Information direkt schon vor, wie er etwas zu empfinden und zu beurteilen hat. Oft soll er zielgerichtet emotionalisiert werden. So wird er jedoch unbemerkt ein Stück weit entmündigt und hat kaum die Wahl, welche Themen ihn beschäftigen und wie er sie einordnet, ohne zugleich irgendwo anzustoßen und verbale Prügel zu riskieren. Insofern hat er kaum eine Wahl als sich mitreißen zu lassen und sich wie in einem Automatismus mitzuempören. Mit einem demokratischen Meinungsbildungsprozess hat das jedoch nicht viel zu tun – viemehr ist dieser ochlokratischer Natur.
Inmitten der Informationsschlachten, denen man als Mensch im Laufe seines Lebens pausenlos ausgesetzt wird, ist es umso wichtiger, diese Mechanismen zu erkennen und zu entschlüsseln. Wer mehr als nur „up-to-date“ sein möchte oder irgendwie mitreden will, sondern substantiiert, mündig und empathisch in den Meinungsaustausch treten will, der sollte in diesem und ähnlich gelagerten Fällen mit Respekt vor den Opfern, den traumatisieren Rettungskräften und den bangenden Angehörigen ein Stück hinter den von dem Unglück unmittelbar betroffenen und traumatisierten Personenkreis zurücktreten und die juristische Beurteilung des Unglücksfalls in erster Linie den Experten überlassen.
Im Falle des vorliegenden Zugunglücks sind die Ermittlungen faktisch gerade erst angelaufen. Aber auch Ermittler sind Menschen und spüren den Druck des Öffentlichkeit, welche meist schnell Köpfe rollen sehen will. Dies erhöht die Gefahr, dass Fehler Einzug in die Ermittlungsarbeit finden. Nicht zuletzt ist dies für die Suche nach der Wahrheit höchst hinderlich.
Ist man als Bürger mit den Lebensumständen, die einem von der Politik geboten werden, unzufrieden und hat das Vertrauen in das Funktionieren des Rechtsstaat verloren, so kann man seinem Unmut problemlos an der Wahlurne entsprechend Ausdruck verleihen. Sofern man natürlich den nötigen Mumm aufbringt… Nur sollte man dabei nicht die Toten instrumentalisieren.