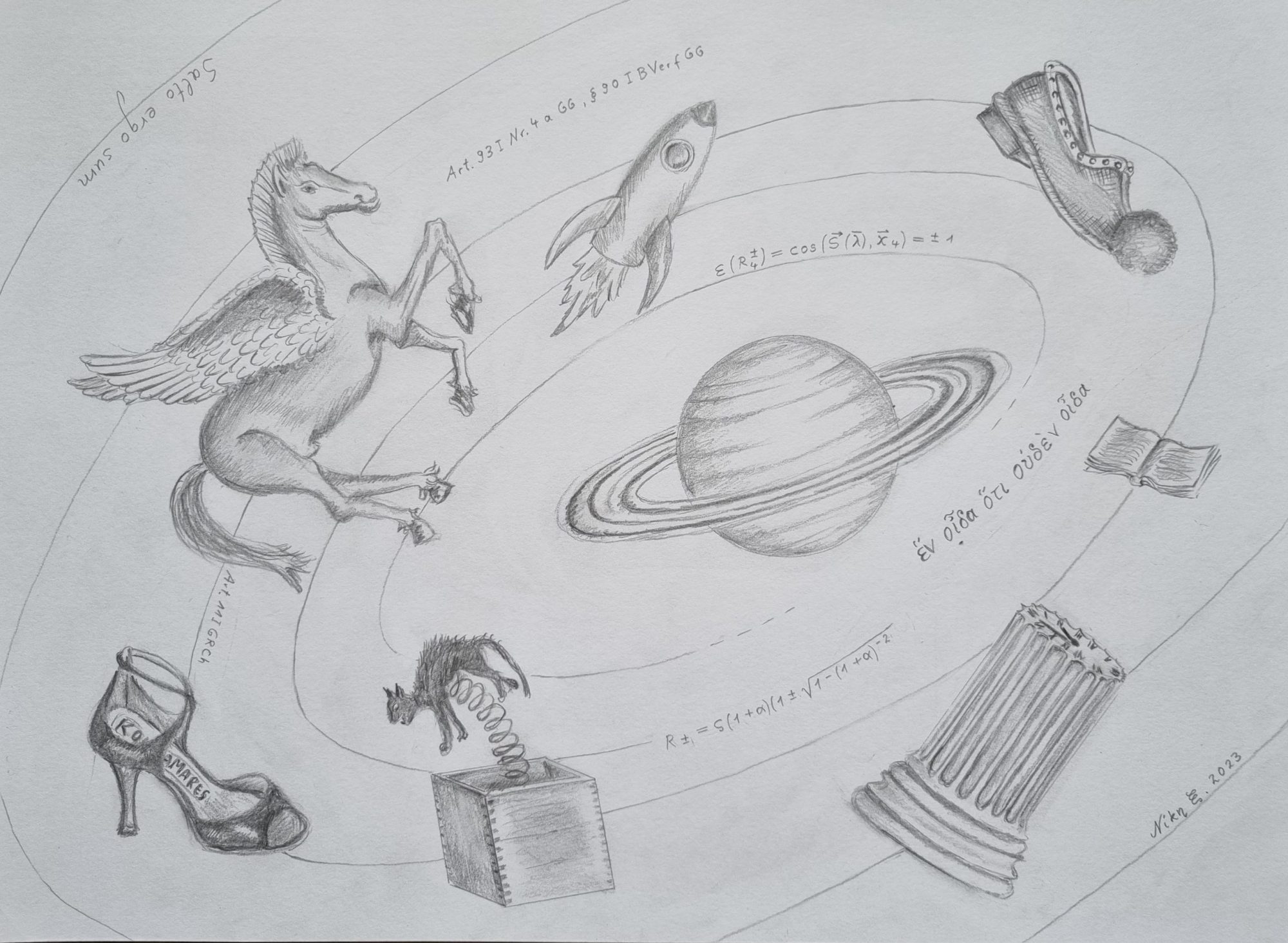Tango heißt Leben!
Die meisten aktiven Tangotänzer würden diese These wohl vorbehaltlos und ohne zu zögern unterschreiben. Tango ist zweifelsohne Lebensfreude pur! Im Umkehrschluss bedeutet dies leider aber auch: Tanzt du nicht, bist du tot. Genauer gesagt tot für die Tango-Community im metaphorischen Sinne. Mitmenschen, die mit Tango nix am Hut haben, sind per se nicht auf ihrem Radar. Gleiches gilt für ehemalige Milongabesucher: die gelten quasi als weg vom Fenster. Wie ich zu dieser Aussage komme? – Aus eigener Erfahrung.
Mein letzter Milongabesuch war Anfang Dezember 2023. Dass ich mich auf die Piste geschmissen habe, liegt also mittlerweile drei Monate zurück. Und jaaa, ich lebe noch! :–) Sogar sehr gut und überaus zufrieden.
Milonga-Detox
Es ist keine bewusste Entscheidung gewesen, mir eine Auszeit von der Ronda zu nehmen, auch kein Entzug oder Ähnliches. Im Gegenteil, sonderlich „süchtig“ war ich zuletzt gar nicht mal. Vielmehr überdrüssig. Man kommt, man tanzt, man unterhält sich, man geht, man stellt sich als namenloser Tänzer zur Verfügung und benutzt sein Gegenüber als selbigen. Das ständige Hin- und Her, die Marktgepflogenheiten, Miradas, Cabeceos, die Spielchen, seine Füße quälen und trotzdem dabei freundlich Lächeln…das alles fühlt sich mit der Zeit so an, als befände man sich in einer seltsamen Zeitschleife. Alles ist schon einmal in einer ähnlichen Form dagewesen, belangloser Smalltalk eingeschlossen. Zuletzt hatte ich im Grunde nur noch aus Gewohnheit regelmäßig Milongas besucht. Die Hochgefühle beim Tanzen wurden immer seltener und blieben schließlich immer öfter aus. Nach der letzten Milonga dann hatte ich schlicht keinen Grund mehr, eine weitere zu besuchen, ließ es einfach bleiben und stürzte mich wieder vermehrt in andere Lebensbereiche. Es gab ein wunderbares Leben vor dem Tango – insofern muss es theoretisch ein gutes Leben nach dem Tango geben.
Mehr Zeit für Anderes
Da Weihnachten jedenfalls vor der Tür stand und ich mich auf die Zeit mit meiner Familie freute, fiel mir meine Milonga-Abstinenz nicht schwer. Es mangelte mir noch nie an Kreativität bei der ausgewogenen und sinnvollen Ausgestaltung meiner Freizeit. Vor diesem Hintergrund konzentrierte ich mich auf das, was ich gewinnen würde und nicht auf das, was ich verloren hatte. Verloren war ohnehin nichts. Es ist schließlich keine endgültige Abkehr.
Nur, endlich habe ich seither mehr Zeit für andere Dinge, die mir wichtig sind. Deutlich mehr Raum für Familie und Freunde sowie mehr Zeit, um laufende Herzensprojekte zu verfolgen und entschiedener voran zu bringen. Mehr Zeit für andere Leidenschaften. Als ich anfing Tango zu praktizieren, nahm ich mir vor, mit einem Bein in meinem alten Leben zu bleiben. Dem Tango wollte ich nicht alles opfern. Wieso auch? Was schuldete ich ihm? Ich war eine Neugeborene in dieser Welt. Der Tango sollte sich mir erst einmal als nützlich erweisen, sich bewähren und mein Leben bereichern. Dann wird man sehen. Ich wollte ihn erfahren, aber deshalb nicht alles für ihn stehen und liegen lassen. Ältere Freundschaften wollte ich daher z.B. nicht zu sehr vernachlässigen. Darauf war ich sehr bedacht und bin es noch. Und andere Interessen verfolgte und pflegte ich bewusst weiter, um Sicherheitsnetze zu haben. Und auf meinen Weitblick bin ich heute besonders stolz.
Klar geht das alles auch neben Milongabesuchen, aber die Fahrten, die Kommunikation, das Stylen, Schuhpflege, gedankliche Aufarbeitung, Reflexion usw. nimmt nun einmal unleugbar Energie und Zeit in Anspruch, die an anderen Ecken und Ende dann logischerweise fehlt.
Weitere Beweggründe wurden mir jedoch erst mit zunehmender Distanz zu dieser Welt bewusst.
Monopol
Mich störte schon länger latent die Überhöhung der Milonga als fast schon monopolartige Begegnungsstätte für den Tango Argentino. Um Tango zu schätzen und auszuleben, muss man jedoch genau genommen keine einzige Milonga besuchen. Milongas haben natürlich zwar ihren Zweck, jedoch ist Tango viel mehr als das. Darauf komme ich gleich zu sprechen.
Cliquen-Bildung
In Milongas meiner Gegend gab es Cliquen, darunter meist elitär anmutende Gruppen. Diese waren relativ geschlossen. Fremden Besuchern sowie Anfängern erwiesen sie so gut wie nur selten die Ehre einer Tanda. Dagegen unternommen haben die Gastgeber meines Wissens nichts. Sie wollen dies in der Regel nicht erkennen oder fördern die Cliquenbildung gar oder wissen schlicht nicht, was sie dagegen unternehmen sollen. Für einen lebendigen und toleranten Tango ist das jedenfalls sehr kontraproduktiv.
Platzmangel
Gute Milongas sind überlaufen und auf schlechten zieht es einen nicht so recht auf die Tanzfläche. Kennt Ihr das auch?
Der soziale Aspekt von Milongas ist an sich eine nette Grundidee und man möchte ja den Tango auch gerne mit anderen teilen. Aber das Erfordernis, sich auf engsten Raum zu beschränken, pfercht meine Seele manchmal einfach ein. Es gibt sogar Workshops, bei denen man gezielt lernt, den geringen Raum auszuschöpfen. Manchmal möchte ich mich räumlich einfach so richtig entfalten. Da stoßen Milongas und der dahinterstehende Salonstil generell an ihre Grenzen.
Alternative Energiequellen
Um sich aus der Milonga-Szene zurückzuziehen, muss man über ausreichende andere Energiequellen verfügen, sonst leidet man unweigerlich unter dem Entzug. Bei der überwiegenden Mehrheit ist dies nicht der Fall. Tangotänzer sind nun einmal besonders besessen und dahingehend schlicht loco. Eine Tatsache. Das geht soweit, dass sie sich fast ausschließlich für Tango interessieren. Oft investieren sie ihre gesamte Freizeit in den Tango. Interessanterweise versäumen sie es, sich ab einem bestimmten Punkt dabei auch technisch weiter zu entwickeln und werden bequem. Viel Herumtreiberei. Viel Klüngelei. Viel Lechzen nach Umarmungen und Bestätigung. Wenig Disziplin.
Motiv: Oberflächlichkeit
Während damals bei meinem Einstieg die meisten Kursbesucher im Tangounterricht darauf aus waren, möglichst schnell fit für die Milonga zu werden, bevorzugte ich schon immer mehr Begegnungen mit etwas mehr Tiefgang. Insofern zog ich beispielsweise das Training in Practicás mit einem angenehmen Partner einer Milonga meist vor. Sicher, auch dort herrscht Rondastruktur, aber wenn man den Fluss kurz unterbricht, also mal stehen bleibt, um etwas auszuprobieren oder zu wiederholen, sind die anderen Trainierenden auf der Fläche meist tolerant und überholen einen mal eben. Und sind sie es nicht, sind sie am falschen Ort und wollen aus einer Practicá eine Milonga machen. Einfach in entspannter Atmosphäre ein bisschen experimentieren, ohne dieses überflüssige gekünstelte Getue und Aufblasen. Das genieße ich sehr.
Oft werde ich von Tänzern eingeladen, sie zu Milongas zu begleiten. Ihre Bereitschaft , dort ein oder zwei schöne Tandas mit mir zu verbringen, ist nett gemeint. Und an sich ehren mich solche Anfragen. Aber ich empfinde es als ein viel größeres Kompliment, wenn man(n) mit mir z.B. einen Workshop oder eine Practicá besuchen möchte. Das hat eine andere Qualität. Es bedeutet nämlich, dass derjenige sich eingehender mit mir beschäftigen möchte und die Zeit mit mir als Bereicherung empfindet.
Am Ende des Tages wünscht sich doch jeder echte Wertschätzung und nicht etwa schnellen Instantkaffee To Go. Wann haben wir – als Menschen – eigentlich angefangen, unsere Ansprüche an uns selbst und an unsere Mitmenschen herunterzuschrauben? Wann genau ist das passiert? Und warum? Es ist widersprüchlich: viele erhoffen sich echte Nähe, Freundschaft und Liebe vom Tango, wollen aber nicht stehen bleiben und in die Tiefe gehen. Auf den Aspekt Nähe möchte ich gleich nochmal zu sprechen kommen.
Blendung
Aufgrund eines Vakuums im eigenen Leben verklären viele Tänzer die Milonga. Oft wird die lokale Community zu einer Art Ersatzfamilie oder gar Therapiezentrum für die angeschlagene Seele. Die Milonga soll gewissermaßen richten, wo zuvor im Leben – also beruflich oder privat – etwas schiefgelaufen ist. Aber die Rechnung geht nicht auf. Genau genommen geht sie nie auf. Das Leben besteht nicht nur aus Tanz, und Tango heilt auch keine Wunden, sondern betäubt sie allenfalls temporär. Generell plädiere ich daher dafür, dem Tango nicht übermäßig viel aufzubürden, sonst droht spätenstens im nächsten Schritt Realitätsverlust.
Dieser Realitätsverlust ist jedoch nicht selten so gewollt und wird durch gezielte Einflussnahme von zentralen Figuren der Community gefördert. Insofern sind die Geblendeten nicht allein Schuld an ihrer Blindheit. Um Kundenbindung zu betreiben, wird von Milongaveranstaltern, welche oft gleichzeitig auch Lehrer sind, der Zusammenhalt der Community künstlich herbeigeredet. Eine Mär. Zum Beispiel war schon offen die Rede von „Kreisen“, also „äußere Kreise“ und „innerer Kreis“. Dies suggeriert, dass der Tanzschüler sich zum inneren Kreis hinarbeiten kann, wenn er sich genug anstrengt und sich in sonstiger Weise als würdig erweist. Und mit Anstrengung ist nicht schneller Lernfortschritt gemeint. Vielmehr soll der Tanzschüler dem Unternehmen (oder dem Lehrer ganz privat) von Nutzen sein.
Wer jedenfalls Kreise oder besser gesagt Studio-Communities absteckt, definiert damit automatisch ein Wir und die Anderen. Wozu soll das bitteschön gut sein? Ich finde eine liberale Tangoszene, in der alle mit offenen Armen willkommen geheißen werden, viel erstrebenswerter als Exklusivität und Pseudofamilien. Von diesem ganzen Illuminati-Quatsch sollte dringend Abstand genommen werden.
Der propagierte „Zusammenhalt“ ist eine Illusion, der negative Dinge wie Exklusion und Konkurrenz schürt und bereits deshalb schon zum Scheitern verurteilt ist, weil sich die meisten Tänzer de facto kaum für ihre Mitmenschen interessieren und wenn doch, dann nur flüchtig, in der Hoffnung seinen Kaffee am nächsten Morgen nicht wie sonst alleine trinken zu müssen. Womit sich der Kreis schließt und wir wieder beim Instantkaffe wären… :–D
Kinderspielplatz
Die Gespräche auf Milongas beschränken sich, wie oben bereits geschildert, oft auf oberflächlichen Smalltalk. Der Nächste wartet schon und seine Umarmung fühlt sich auch nicht schlechter an die des Vorgängers. Begegnungen werden oft nicht als etwas Besonderes identifiziert und geschätzt. Jeder gilt als ersetzbar. Die Leute meinen es in ihrer kurzen Angebundenheit und Oberflächlichkeit aber nicht unbedingt böse. Wie Kinder im Sandkasten sind viele von ihnen einfach nur ignorant, stark selbstbezogen und vergnügungssüchtig. Verlässt ein Kind, mit dem man eben noch rege gespielt hat, den Spielplatz, ist es aus den Augen und aus dem Sinn. Es ist schlicht nicht mehr verfügbar für das Spiel und insofern nicht mehr interessant. Kaum jemand interessiert, was es sonst so im Leben treibt.
Aktuell bemerke ich beispielsweise stark, dass sich viele Tangobekanntschaften desinteressiert abwenden, seitdem ich mich nicht mehr auf Milongas blicken lasse und nicht für die üblichen Spielereien verfügbar bin. Hätte ich kein solides soziales und familiäres Netz, von dem ich mich behütet und getragen fühle, wäre das ein echtes Problem. Aber, wie mein erfahrener Lehrer mir einmal zutreffend erklärte, stellt Tango für viele Tänzer die alleinige Grundlage ihres Sozialebens dar. Traurig, aber wahr, wie ich heute weiß.
Bei den meisten Tänzern gehen die Rollläden runter, sobald ein Gespräch länger als 10 Sekunden auf andere Lebensbereiche gelenkt wird. Und von den unzähligen anderen Bereichen und Aspekten des menschlichen Lebens wollen sie gar nicht wissen. Als befänden sie sich in einem tiefen Schlaf und würde einen wunderbaren Traum träumen, aus dem sie nicht geweckt werden wollen.
Erzähle ich bei Begegnungen mit anderen Tänzern davon, was ich außer Tango tue, mich umtreibt oder einnimmt, was ohnehin nur auf Nachfrage tue, lenken die meisten von ihnen den Dialog kurze Zeit später wieder zurück in ihre Wohlfühlzone: Tango. Klar macht es Spaß über ihn gemeinsam zu philosophieren, aber es gibt auch viele andere Themen, Ereignisse und Lebensbereiche, über die sich zwei Menschen austauschen können.
Viele reagieren dann leicht irritiert, wenn ich dann mal auf das Pferd nicht aufspringen möchte. Ich mag es nicht, auf Tango reduziert zu werden und genieße daher jedes Gespräch mit einem Tangotänzer, das sich um alles Mögliche dreht – nur nicht um Tango. Vereinzelt, jedoch eher selten, treffe ich Leute, die das ähnlich sehen wie ich. Sie sind positiv überrascht und freuen sich, wenn sie an jemanden geraten, bei dem sie von sich und ihrem Leben ein paar Takte frei erzählen können und ihnen vorurteilsfrei zugehört wird.
Realitätsverlust
Der Tango verführt auch leider sehr leicht. Man verliert sich sehr schnell. Plötzlich scheint alles möglich: Abgehalfterte und verlassene Frauen, die den Zenith ihrer Attraktivität lange hinter sich haben, sonst im Alltag niemand besonders beachtet oder als Sex- oder Lebenspartnerin in Erwägung gezogen hätte, fühlen sich plötzlich wieder jung und begehrt, wenn sie im geschlitzten Bleistiftrock und hübschen Sandaletten an ihren sehnigen Füßen, halbherzig geführte Voleos halbherzig ausführen, ohne dass dies auch nur ansatzweise erkennbarer Ausdruck ihrer eigenen Persönlichkeit oder echter Lebensfreude wäre. Aber auch beruflich erfolglose Männer, die teilweise weder eine Wohnung noch ansatzweise einen Plan für ihre Zukunft haben, werfen sich für die Milonga in Schale, baden geradezu in Eau de Toilette und bilden sich ein, sie genössen vielleicht doch einen gesellschaftlichen Status, wenn ihnen aufgrund des häufig vorherrschenden Damenüberschusses die Miradas nur so zufliegen und der Gastgeber ihnen wohlwollend zur Begrüßung auf die Schulter klopft. Vielleicht bietet dieser ihm ja mal einen Job an, als Tango-DJ oder Lehrer vielleicht. Die Leute fühlen sich dadurch gewertschätzt, aber tief im Inneren wissen sie, dass niemand sie wirklich sieht und zwar nicht nur weil die Anderen nicht hinsehen wollen, sondern auch weil sie nicht in Gegenleistung treten wollen, indem sie sich mit ihrem wahren Ich zu erkennen geben.
Wenn man sich das alles vor Augen führt, ist es nur verständlich, dass solche Phantasten sehr auf ihre imaginäre Arena namens Milonga bedacht sind und sich nicht einen Schritt von ihr entfernen möchten, nicht einmal theoretisch im reinen Dialog. Denn draußen in der realen Welt und dortigen Maßstäben, anhand derer man bemessen und bewertet wird, wären sie wieder mit ihren Defiziten, Unvermögen und Versagen konfrontiert und wären gezwungen, ihre Probleme anzupacken. Dazu haben die meisten nicht den Mumm und die Energie. Lieber bleiben sie dann doch Könige und Königinnen ihrer kleinen Scheinwelt und tanzen… Es ist wie in den Hip-Hop-Song von Stromae „Alors en Danse“ aus dem Jahr 2009. Da lautet eine Textzeile: „Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse“ (übers.: „Also gehen wir raus, um alle Probleme zu vergessen. Dann tanzen wir“)
Für viele ist die Milonga leider nur bloße Betäubung und Selbstbetrug. Dabei könnte sie ein wirklich schöner Ort sein, an dem einfach nur der Tango und das Leben gefeiert wird. In anderen Ländern wie zum Beispiel in Spanien ist das so. Auf Milongas, die ich 2022 in Barcelona besucht, waren viele Tänzer offen und authentisch, sie waren wirklich interessiert, woher man kommt, öffneten sich, zeigten ihre verletzliche Seite und erzählten auch frei von sich. Eine meiner schönsten Tandas überhaupt hatte ich mit einem älteren Herren, der beim Tanzen nur so vor Lebensfreude strotzte und mir zum Abschied ein Küsschen auf die Wange gab. Eine andere Mentalität eben. In Deutschland sind viele Menschen leider sozial gehemmt und mischen im Tango mit, weil er irgendwie, sie wissen nicht genau wie, mit Begriffen wie Sinnlichkeit, Leidenschaft und Temperament assoziiert ist. Sie imitieren die Latinos und Südländer, sowohl im Verhalten und in puncto Mode, anstatt gemeinsam einen authentischen deutschen Tango zu kreieren und zu kultivieren. Das Verhalten mancher Tänzer hierzulande ist einfach nur zum Fremdschämen.
Kaum Individualität in der Ronda
Und wenn es dann auf der Tanzfläche zur Sache geht, rocken nur die wenigsten die Ronda mit echter Leidenschaft und Temperament. Meiner Mutter zeigte ich einmal einen kurzen Videoausschnitt aus einem Tango-Marathon bei Kassel. Die Location war prachtvoll und das Tanzniveau vergleichsweise gehoben. Meine Mutter, die zwar viele Tangos gehört und gesehen hatte, aber selbst nie getanzt hat, bemerkte nur verwundert: „Schöner Saal! Also, die Leute sind sehr elegant gekleidet, aber für mich tanzen irgendwie alle das Gleiche.“
Ich war zunächst buff wegen dieser Bemerkung, aber meine Mutter hatte völlig Recht und das lag nicht daran, sie vom Tangotanzen keine Ahnung hatte. Mir selbst fehlte zu diesem Zeitpunkt einfach nur die nötige Außenperspektive, um das zu hinterfragen und zu erkennen. Die Figuren und die Art wie die Tänzer sie ausführten, glichen sich stark. Ständig dieselben Muster. Und nicht nur auf dieser Veranstaltung. Sondern überall ist das so. Kaum jemand wagt etwas Ungewöhnliches und das nicht nur, um Verletzungen zu verhüten. Man kann auch einen individuellen Stil entwickeln, ohne ständig gefährliche Voleos zu schlagen, aber die meisten sind Imitatoren ihrer Lehrer und diese ihrer Lehrer zuvor. Eine endlose Kette der Einfallslosigkeit. Kaum Persönlichkeit und Individualität erkennbar. Und das Schlimmste: nur den Wenigsten siehst man beim Tanzen echte Freude an. Allenfalls Erleichterung, jemanden für die Tanda abgekommen zu haben, mit dem man sich präsentiert in der Hoffnung, irgendwann mit jemandem zu tanzen, den man wirklich will. Und das Ego hat neben dem Instantkaffee vielleicht noch einen Schub Bestätigung rausschlagen können. Hauptsache betanzt, egal wie gut oder wie schlecht oder von wem.
Dabei ist die Möglichkeit an statthaften Figuren, Kombinationen, Effekten, Adornos etc. mathematisch sehr vielfältig. Es ist auch nicht verboten, etwas Neues zu kreieren, wenn es zur Musik und zur Situation passt und den Partner nicht stört. Ich mache das oft, weil ich neben Tango auch elf weitere Tänze im Gepäck habe, aus denen ich mich manchmal bediene. Manchmal geht es auch daneben und ich bringe meinen Tanzpartner damit zu lachen…und dann wir lachen beide. Was gibt es Schöneres!
Ganz Mensch
Um nicht unter die Räder zu kommen, habe ich im Laufe meiner Entwicklung im Tango gelernt, mich lieber an Tänzer zu halten, die neben Tango auch andere Interessen und Talente haben, von denen sie erzählen möchten. Ich genieße es immer sehr, den Menschen hinter dem Tänzer kennenzulernen, selbst oder gerade wenn er Ecken und Kanten oder einen schwierigen Weg zu meistern hat. Es inspiriert mich für mein eigenes Leben und damit auch indirekt für die Charakteristik meines Tanzes.
Wenn man mit einem anderen Menschen Tango tanzt, tanzt man nämlich nicht nur mit dem Ergebnis seiner Tangokurse, Übungsstunden oder Workshops, sondern im Idealfall mit seinem ganzen Wesen und seinem hinter ihm liegenden Weg. Jeder Mensch verfügt über eine einzigartige Biographie und Persönlichkeit, deren Gesamtheit ihn kausal zu einem bestimmten Zeitpunkt an diesen konkreten Ort geführt hat. Man muss sich natürlich nicht über die gesamte Lebensgeschichte austauschen, nur weil man miteinander tanzt; auch ich möchte nicht mein Ohr abgekaut bekommen, wenn gerade ein schönes Lied läuft.
Aber wenn man die Heiligkeit dieser Begegnung nicht erkennt und anerkennt, per se null Interesse an dem Leben und der Persönlichkeit seines Gegenübers aufbringen möchte, jeden tiefergehenden Austausch mit ihm blockiert und diesen obendrein praktisch zum anonymen Tanzgerät degradiert, ist man zum Einen in höchstem Maße respektlos und zum Anderen erfährt man nie das gesamte Potential der Begegnung. Das erlebe und beobachte ich jedoch leider oft.
So nah und doch so fern
Man muss sich das vor Augen führen: Die Paare auf der Milonga tanzen intim umschlungen miteinander, praktisch Hand in Hand, Wange an Wange und Brust an Brust zu Liedtexten über tiefe Gefühle, über Schmerz, Einsamkeit, Liebe und Romantik. Und gleichzeitig sind sie im Herzen kalt. Das ist tragisch, paradox und irgendwie auch pervers.
Einfach mal mit Empathie beobachten, fragen wie es dem anderen geht und kurz zuhören. Und ein ehrliches Kompliment machen, Danke sagen und auch dem Tanzpartner mal einen Kaffee anbieten, bewirkt in vielen Fällen Wunder. Ein glücklicher Tänzer ist nämlich ein guter Tänzer. Win-win.
Keine Selbstverständlichkeit
Ich schreibe grundsätzlich über nichts, wovon ich nichts verstehe. Unzählige Milongas habe ich inzwischen besucht. Genau genommen habe ich meinen Tango hauptsächlich auf Milongas gelernt, da mir wegen dem häufig vorherrschenden Erfordernis der festen Tanzpartnerschaft der Zugang zum Unterricht oft verwehrt blieb. Gelernt habe ich in der Ronda unter großen Schmerzen, musste vielen Clownsspielchen standhalten, nur um ab und zu mal an einen kompetenten und wohlwollenden Tänzer zu geraten. Insofern steht es mir frei, wenn ich angesichts des Bestehens solcher Angebote keinen Kniefall mache. Früher habe ich Energie vergeudet und darüber nachgedacht, ob ich auf dieser oder jener Milonga willkommen bin. Heute ist es umgekehrt, d.h. ich überlege mir vorher, ob die Milonga mir genug anbieten kann, dass ich ihr meine Zeit, mein Geld und meine Energie widme. Von diesem Maß an Unabhängigkeit und Erfüllung habe ich in meinen Anfängen nicht zu träumen gewagt…
Ja, mir ist sehr wohl bewusst, dass das freie Praktizieren von Tango nicht selbstverständlich ist. Durch Pandemien, Krisen oder Kriege könnte dieser Luxus jederzeit unverhofft wieder verschwinden, aber das löst in mir seltsamerweise keine großen Ängste oder Verknappungspanik aus. Während des Lockdowns habe ich den Worstcase bereits schmerzlich erlebt und auch überlebt. Und Fakt ist: Tango findet immer seinen Weg. Notfalls auch in einem Betonbunker tief unter der Erde. Solange ihn ein paar Menschen beherrschen und mit Herz und klarem Verstand praktizieren wollen, mache ich mir um seinen Fortbestand null Sorgen.
Alternative
Nur weil ich also zeitweilig Milongas schmähe, schmähe ich den Tango keineswegs generell. Im Gegenteil. Nach wie vor spielt er eine große Rolle in meinem Denken und Fühlen. Ich höre etwa weiterhin Tangomusik, lese über Tangokultur und -geschichte, grüble über Tango, übe vereinzelt für mich allein auch mal ein bisschen Tangotechnik und arbeite meine Beobachtungen und Erlebnisse in der Tangowelt auf, so wie auch jetzt gerade, während ich schreibe. Letztes Wochenende etwa hatte ich außerdem die Gelegenheit, auf einer wunderbaren Tanzveranstaltung einen Tango vor anspruchsvollem Publikum auf einer kleinen Bühne zu performen. Ein authentischer spontaner Tango, so wie gerade entsteht. Das war mal etwas anderes für mich, etwas Neues.
Im Grunde ist doch Tango überall dort, wo zwei Menschen in der Umarmung miteinander gehen. Ebenso gut kann man ihn spontan auf der Straße tanzen. Oder in angenehmer Gesellschaft im warmen Meer. Letzteres ist ein besonders herausforderndes Erlebnis, wenngleich der Wasserwiderstand jeden Voleo stark ausbremst. Das soll keine Empfehlung sein. Nur Beispiele. Nicht, dass mir hier noch jemand in den Wellen ertrinkt. Besser im Pool ausprobieren. :–) Der langen Rede ein kurzer Sinn: Tango ist mehr als nur Milonga. Tango ist reich!
Fazit
Wie lange meine Milonga-Pause nun noch andauern soll, habe ich nicht festgelegt. Da höre ich auf mein Bauchgefühl. Vielleicht will ich morgen spontan eine Milonga besuchen, vielleicht nächsten Monat, vielleicht auch nie wieder. Zugegeben letzter Fall ist unwahrscheinlich. Meine „Kur“ bekommt mir bisher jedenfalls überraschend gut. Noch vermisse ich die Ronda also nicht, aber wenn es soweit ist, sollen möglichst viele meiner Begegnungen echt und tief sein.
Mich würde natürlich sehr interessieren, ob Du auch schon einmal freiwillig eine längere Milonga-Pause eingelegt hast? Wenn ja, was waren Deine Gründe und wie ist es Dir dabei ergangen? Hattest Du Entzugserscheinungen? Bist Du schließlich in die Ronda zurückgekehrt? Wenn ja, was genau hat Dich zurückbeordert? Über Deinen Kommentar würde ich mich freuen!