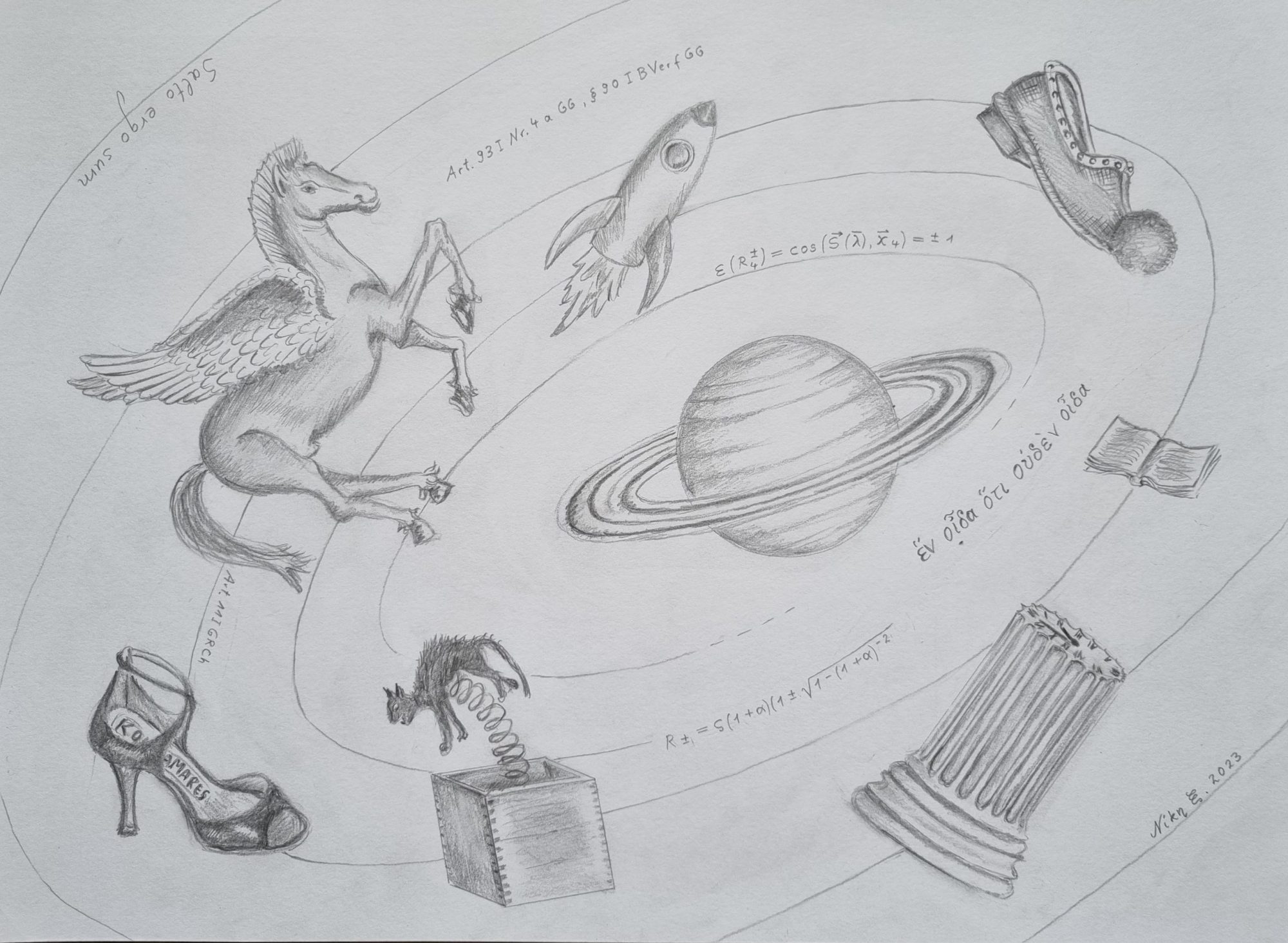Wir schreiben das Jahr 2025 und *Trommelwirbel* unser Planet „steht“ noch! Wir haben allerdings immer noch keine fliegenden Autos im 3D-Verkehr, immer noch keine Hoverboards uuund wir haben uns immer noch nicht ausgerottet! :–D Yeaaahhhh! Nicht, dass die Menschheit es nicht versuchen würde…. Wäre das nicht Grund genug um zu feiern? Wieso feiern wir überhaupt den Jahreswechsel? Glauben wir, dass das neue Jahr besser wird als das alte und begießen es deshalb? Werden dadurch die Probleme Schlag Mitternacht automatisch Schnee von gestern? Neues Jahr = neues Glück?
Also über den Sinn des Unterteilens von Lebensabschnitten und Zeit will ich gar nicht streiten. Die Menschen klammern sich gerne an bestimmte Strukturen und Konstrukte, selbst wenn eigentlich niemand so genau weiß, was Zeit bzw. Raumzeit ist. Astronomisch hat das Kalenderjahr fraglos zwar seine Grundlage. Allerdings würde ich nebenbei bemerkt dafür plädieren, den gregorianischen Kalender durch den neojulianischen zu ersetzen, einfach weil dieser präziser mit dem Sonnenjahr korreliert.
Den Jahreswechsel feiere ich übrigens bevorzugt fröhlich und ausgelassen, aber vor allem auch deshalb, weil man das neugeborene Jahr im Feuer taufen darf. Ja, ich liebe Feuerwerk und besonders Batterien mit schönen optischen Effekten. Der Lärm an sich ist da für mich weniger ausschlaggebend. Für mich ist das Zünden von privatem Feuerwerk einfach Tradition, welche, verantwortungsbewusst gelebt, viel Freude bereitet. Allerdings beobachte ich auch leider immer öfter problematische Individuen, die getarnt in der dunklen Silvesternacht und den zahlreichen Detonationen ihren Gewaltphantasien freien Lauf lassen, indem sie arglose Nachbarn und Passanten feige aus dem Hinterhalt heraus mit Feuerwerkskörpern attackieren. Als befänden sie sich bei Jahreswechsel in einer rechtsfreien Zwischendimension. Da habe ich auch schon selbst negative Erfahrungen gesammelt und treffe entsprechend Vorsorge meinen Selbstschutz betreffend.
Seit dem ursprünglich pandemiebedingten Verbot der Überlassung von Pyrotechnik der Kategorie F2 an Verbraucher in den Jahren 2020 und 2021 wird jedes Jahr vermehrt ein generelles Verbot von privatem Feuerwerk diskutiert. Nichts gegen einen gepflegten Meinungsaustausch, aber irgendwie erscheint mir die Debatte um das Böllerverbot zunehmend konstruiert. Man kann über alles diskutieren und ich persönlich bin auch nicht immun gegen gute Argumentation. Mit dem moralischen Narzissmus mancher Feuerwerksgegner, die ihren zwanghaften Geltungsdrang und ihre Herrschsucht nur hinter vernünftig anmutenden Argumenten verbergen, denen aber in Wahrheit die feinstaubbedingte Umweltbelastung oder der Stress der Tiere durch den Lärm völlig gleichgültig sind, habe ich hingegen ein Problem. Ungeachtet dessen halte ich nichts davon, diese Tradition autoritär einzustampfen und zwar aus verschiedenen Gründen nicht. Einer davon ist die illegale Anschaffung von teils gefährlichen Feuerwerksprodukten aus dem Ausland, die damit gefördert würde. Aber es gibt noch viele weitere. Sicherlich gäbe es Kompromisse, die bisher weder erwogen noch ausgeschöpft wurden. Aber genug hiervon.
Ein Freund hat mir neulich eine WhatsApp geschickt. Er machte sich Sorgen, weil ich mich schon länger nicht gemeldet hatte und auch keine neuen Blogposts veröffentlicht hatte. Nun, die Vor-/Weihnachtszeit hatte ich genutzt, um mich entspannt und bewusst überwiegend offline im Kreise meiner Familie zu erholen. Da es mir an nichts fehlte und ich eine tolle Zeit genoss, hatte ich keine Zeit zum Bloggen und auch kein besonderes Mitteilungsbedürfnis. Mittlerweile bin ich jedoch unweigerlich aus meiner heilen Welt erwacht. Die Weihnachtsdeko lasse ich allerdings noch etwas hängen. Zum Einen, weil sie mir einfach gefällt und zum Anderen möchte ich am alten Jahr noch ein wenig länger festhalten.
Viele Leute fassen sich zum Jahresanfang gute Vorsätze. Aber das ist eine Illusuion, eine Selbsttäuschung. Denn das neue Jahr führt diese nicht zum Erfolg, sondern man muss sie schon selbst aktiv umsetzen. Insofern macht es keinen Unterschied, ob man sich etwas zum 1.01. oder an irgendeinem anderen Datum vornimmt. Der Nikotinentzug oder das Abnehmen werden nicht leichter, nur weil man ihn zum Jahresbeginn plant. Da mir alle meine Laster inzwischen längst ausgegangen sind, habe ich mir meinen Lifestyle betreffend nichts Konkretes vorgenommen, außer vielleicht meinen persönlichen Kurs fortzusetzen und auf meine Liebsten und mich achtzugeben.
Im neuen Jahr angekommen, beschleicht mich nämlich das ungute Gefühl, dass große Pläne nicht viel Sinn machen, dieses Jahr in politischer und gesellschaftlicher Hinsicht schlechter wird als das vorherige und man als Bürger von daher mit seinen Energiereserven klug haushalten sollte. Mein Pessimismus rührt nicht daher, dass heute Donald Trumps Amtseinführung stattfand. Wobei seine Wiederwahl unglaublich ist! Aber ich möchte es mal diplomatisch ausdrücken: jedes Volk bekommt die Regierung, die es verdient. Punkt.
Vielmehr stört mich in diesem Kontext, dass wir hierzulande ständig darüber diskutieren, was die USA treiben. Als würden sie uns in Europa mitregieren. Auch in anderen Länder gibt es interessante und erwähnenswerte Entwicklungen, über die die Medien kaum ein Wort verlieren. Trump will doch America great again machen. Bittesehr. Ich habe damit überhaupt kein Problem, sofern wir in Europa nicht gleichzeitig kleingemacht werden sollen. Bei solchen ambitionierten Bestrebungen müssen wir aber doch nicht aktiv mithelfen, oder? Sollten wir unsere Nasen, unabhängig davon, nicht zur Abwechslung mal in unsere eigenen Angelegenheiten stecken? Haben wir etwa in Deutschland, Griechenland, Frankreich usw. nicht unsere jeweils landeseigenen „Baustellen“, die wir stattdessen anpacken sollten?
Am 23. Februar wird der Bundestag gewählt und die Umfragewerte würde ich nicht als prickelnd bezeichnen. Mit etwas Pech regiert bald eine rechte Partei mit. Zwar behaupten (fast) alle anderen Parteien, dass sie nie mit der AfD koalieren würden, aber wenn die Macht erst einmal zum Greifen nahe ist, werfen manche Menschen ihre moralischen Bedenken schnell über Bord. Überraschen würde es mich jedenfalls nicht. Man sollte den Teufel zwar nicht an die Wand malen, aber nie wieder ist vielleicht schon früher als wir dachten… Offenbar wachen einige Politiker langsam auf. Wie ich beim Verfassen dieses Beitrags nebenher lese, soll der Bundestag nächste Woche über ein Parteiverbot beraten. Etwas spät, wenn man mich fragt….
Je näher man sich die politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen unter die Lupe nimmt, desto unglücklicher erscheint mir die dahinterstehende Kausalkette. Ein bisschen erinnert das Ganze an eine Massenkarambolage auf einer vereisten, voll ausgelasteten fünfspurigen Autobahn. Das Unglück wurde nach meiner Einschätzung mit dem Bruch der FDP mit der Ampel in Gang gesetzt. Wobei man bereits die Bildung der Ampelkoalition selbst anzweifeln könnte. Wie wir gesehen haben, verderben zu viele Köche den Brei. Aber bleiben wir beim Bruch. Das Timing war aus meiner Sicht jedenfalls sehr ungünstig: Wäre die Regierung für den Rest der Legislaturperiode fortbestanden, so wäre zumindest noch ausreichend Zeit geblieben, ein besseres Fundament für ein entsprechendes Verbotsverfahren zu bilden. Aber mit diesem Schnellschuss wird das vermutlich nix. Gerne würde ich mich da täuschen. Der Geist scheint jedenfalls längst aus der Flasche. Anstatt dies zu erkennen und zu verhindern, haben wir uns die ganze Zeit bevorzugt den Problemen anderer Länder gewidmet und uns mit anderen Themen beschäftigungstherapieren lassen. Saubere Leistung!
Wäre diese in Gang befindliche Karambolage jedenfalls eine Szene aus einem Actionstreifen, könnte wir einfach wegsehen bis das Grauen vorüber ist. Aber leider ist sie Realität. Ich erlaube mir mal kurz, weiter vorzugreifen: Falls der Worst-Case eintreffen sollte, die Demokratie im weiteren Verlauf zu Fall gebracht wird und Menschenrechte bestenfalls kleingeschrieben werden, benötigen wir hier in Deutschland und Europa möglicherweise wieder Hilfe. Hilfe von Freunden. Von Russland können wir nicht viel erwarten; Deutschland hat den Russen längst und nachhaltig die Freundschaft aufgekündigt. Diese haben im Zweiten Weltkrieg außerdem schon genug Leben geopfert, um Europa vom Faschismus zu befreien, auch wenn sich derzeit kaum jemand mehr für Geschichte oder Fakten interessiert. Der Verbleib von TikTok etwa ist ja auch so viel interessanter…. Aber unsere amerikanischen Freunde könnten uns – mit gewohnt eleganter Verspätung – theoretisch zur Hilfe eilen und aus der Patsche helfen, falls nötig, aber Trump ist versierter Geschäftsmann und das würde er sich sicherlich einiges kosten lassen. Dann würden wir im Gegenzug am Ende doch noch mitregiert. Schachmatt.
Ach Ihr Lieben…. politische Gedankenspiele stimmen mich im Moment eher pessimistisch. Idealerweise sollten wir mit einem Quäntchen Menschenverstand erst gar nicht in der Patsche landen. Unsere Freiheiten zu verteidigen und unsere Demokratie zu beschützen ist nicht schwer, solange wir die Chance nutzen und es jetzt tun. Das geht noch(!) völlig friedfertig und unblutig, indem wir ganz einfach wählen gehen und dabei hoffentlich die richtige Wahl treffen.
Was auch immer uns die Zukunft bringt, ich wünsche Euch ein glückliches Jahr 2025!